Interview mit unserem Geschäftsführer Marc Joss in der AZ - 23.06.2025
Geposted von Switcher Content am Juni 23, 2025Aargauer Zeitung 23.06.2025 - Claudia MeierVor fünf Jahren liess der Aargauer die bekannte Kleidermarke, die 2016 in Konkurs ging, wieder auferstehen. Am Firmensitz in Frick spricht Geschäftsführer Marc Joss über Umsatzzahlen, einen grossartigen Fehler bei der Rückkehr, die Konkurrenz aus China sowie mögliche Expansionen – auch ins Ausland.
Die Kleidermarke Switcher wurde 1981 vom Studenten Robin Cornelius in Lausanne gegründet. Das Konzept, T-Shirts und Sweatshirts in über zehn Farben und verschiedenen Grössen ab einem Schweizer Lager anzubieten, war damals revolutionär. Heute wissen viele Leute nicht mehr, ob es die Marke mit dem gelben Wal-Logo noch gibt. Nach dem Konkurs hauchte ein ehemaliger Angestellter Switcher 2020 neues Leben ein. Mittlerweile befindet sich der Hauptsitz mit Zentrallager in einer Garage in Frick. Geschäftsführer Marc Joss hat erst vor vier Monaten ein eigenes Büro bezogen.

Im Schweizer Online-Bekleidungssektor scheint es nicht gut zu laufen. Für das erste Quartal 2025 liegt der Umsatz rund 10 Prozent unter dem Vorjahreswert. Wie sieht es bei Switcher aus?
Marc Joss: Wir sind antizyklisch unterwegs, weil wir unser Potenzial noch nicht erreicht haben. Das heisst, wir wachsen aktuell jeden Monat zweistellig gegenüber dem Vorjahr. Andere Marken sind nach Corona aus einem enormen Wachstum herausgekommen. Switcher hingegen war bei Pandemiestart neu auf dem Markt. Wir mussten zuerst herausfinden, wo wir überhaupt hinwollen.
Am Umsatzeinbruch sei die Fast-Fashion-Konkurrenz aus China wie Temu oder Shein schuld, sagt die Branche. Sehen Sie das anders?
Ich bin gegen das Statement, dass sich nachhaltige Kleidung nicht verkaufen lasse. Das sind meiner Meinung nach Entschuldigungen, um zu sagen, unser Business läuft momentan nicht oder unsere Produkte passen unserem Zielpublikum nicht. Es gibt derzeit einige Marken, bei denen es gut läuft. Dazu gehören in unserer Region Chicorée Mode und Zebra Fashion. Sie sind nicht gleich positioniert wie wir und sprechen eine andere Kundschaft an. Deren Strategie mit On- und Offline-Verkaufsstellen scheint jedoch aufzugehen. Mit anderen Worten: Nicht alle haben Umsatzeinbussen.
China mischt den Schweizer Markt aber schon auf.
Tatsächlich entziehen chinesische Plattformen dem Schweizer Detailhandel weiterhin über eine Milliarde Franken Umsatz, teils auf unfaire Weise. Wir müssen uns dieser Konkurrenz stellen, aber künftig müssen für alle die gleichen Regeln gelten. Hier ist auch die Politik gefordert.
Sie haben die traditionsreiche Kleidermarke übernommen. Die T-Shirts von Switcher gelten als robust und formbeständig. Wie kann eine solche Firma in der Schweiz überleben?
Ich war kürzlich an der Generalversammlung von Swiss Textile. Das ist der Verband des produzierenden Gewerbes in der Schweiz, aber auch der Marken. Die Textilbranche im Land ist sehr vital. Das produzierende Gewerbe ist innovativ. Es gibt viele junge, erfolgreiche Marken, die sich gut positioniert haben. Die haben hybride Produktionen mit Wertschöpfung in der Schweiz, vielleicht Näharbeiten in Portugal und einem Anteil aus Indien. Aus der Schweiz kann man gut eine Kleidermarke führen. Dafür gibt es genügend Beispiele.
Switcher ging 2016 in Konkurs. Das Personal erhielt den April-Lohn nicht mehr und der Geschäftsführer tauchte ab. Wie überraschend kam das Firmenende damals für Sie als Angestellten, der seit 15 Jahren mit an Bord war?
Auf Stufe Direktion hatten wir gewisse Informationen. Wir waren aber immer der Meinung, dass es eine Lösung gibt mit der Überführung der Firma in eine Auffanggesellschaft und einem Neustart. Vieles war schon aufgegleist, aber die beiden Inhabergruppen fanden sich einfach nicht. Sie entschieden sich für den Konkurs. Jede Seite hatte ihre Geschichte. Ich kenne beide. Mein Wunsch wäre es gewesen, möglichst schnell mit einem Teil der Angestellten weiterzumachen, damit man die Marktanteile nicht verliert und mit der Kundschaft in Kontakt bleibt.
Stattdessen folgte ein Rechtsstreit um die Marke. Warum wagten Sie später einen neuen Anlauf?
Mit meinem damaligen Arbeitgeber Werk5 liessen wir zuerst eine kleine Switcher-Kollektion mit zehn Modellen in Lizenz produzieren. Dann kam der heutige Investor auf mich zu. Das ist eine Produktionsfamilie aus Tiruppur in Südindien. Sie kannte Switcher schon, weil sie für unseren alten indischen Investor Stoff produziert hatte, und hatte den Wunsch, in der Schweiz eine eigene Marke zu führen. Für das Operative suchte sie jemand, der die Geschäftsführung und den Lead übernimmt.
Wer besitzt nun die Markenrechte?
Die Markenrechte sind weiterhin bei den Leuten, denen sie Switcher 2014 verkauft hatte. Mit dem Investor haben sie einen Lizenzvertrag. Ich selbst verfüge auch über einen kleinen Anteil an den Markenrechten. Denn wir bezahlen uns selbst keine Managerlöhne, sondern ein normales KMU-Gehalt.
Vom ehemaligen Gemeindehaus Elfingen aus sind Sie Anfang 2020 mit der neuen Handelsfirma gestartet. Wie läuft die Zusammenarbeit mit Indien?
Wir stehen in täglichem Austausch. Aktuell beschäftigen uns das Wachstum und die damit verbundene Planung. Wir wollen möglichst alle Produkte über Seefracht einführen. Das hat einerseits mit dem CO2-Ausstoss zu tun und andererseits mit dem Preis. Luftfracht ist derzeit sehr teuer. Das wird zu einer Herausforderung, wenn sich unsere Zahlen in einzelnen Geschäftsbereichen verdoppeln. Bauen wir jetzt ein grösseres Lager auf? Der Platz bei uns ist limitiert. Wir müssen ökonomisch damit umgehen. Zudem arbeiten wir aktuell an vielen Neuentwicklungen.

Wie wird sich das Sortiment verändern?
Wir lassen unsere günstige Produktelinie Whale auslaufen. Obwohl es schon früher Diskussionen gab, machten wir bei der Rückkehr den grossartigen Fehler und führten diese Untergruppe weiter. Zudem klären wir ab, ob wir das Sortiment in Richtung technischer Bekleidung oder Regenschutz erweitern. Unsere Zielgruppe ist klar 30+. Basic-T-Shirts ohne Logo sind zwar auch bei der Generation Z beliebt. Das ist für uns aber kein Grund, die Zielgruppe auf 16+ auszuweiten.
Wie gross ist der Anteil an Firmenkleidern?
Switcher-Gründer Robin Cornelius setzte von Anfang an auf Geschäftskunden. Heute beträgt deren Anteil etwa 50 Prozent und ist recht stabil. Die unifarbenen Sweatshirts und T-Shirts waren auch im Retailgeschäft gefragt. Die Firma nahm hier früh eine Vorreiterrolle ein.
Welcher Bereich wächst am stärksten?
Unser eigener Webshop und die Online-Marktplätze. Neu arbeiten wir mit Zalando Schweiz zusammen. Der Handelsbereich ist sehr schwierig geworden. Multilabel-Verkaufsläden werden immer seltener. Selber Läden aufzubauen, ist extrem teuer, riskant und bindet viel Kapital.
Wer designt die Kleider?
In der Schweiz haben wir Freelancer, die für uns arbeiten, und direkt in der Fabrik noch weitere Leute. Bei mir läuft alles zusammen.
Werden alle Switcher-Produkte in Indien hergestellt?
Ja, für sicher 95 Prozent unserer Kollektion finden alle Produktionsschritte in Indien statt. Zwei Caps beispielsweise werden noch von unserem früheren chinesischen Lieferanten hergestellt.
Bereits 1998 führte Switcher einen Verhaltenskodex für sämtliche Lieferanten entlang der gesamten Produktionskette ein. Wie wichtig ist dieser Nachhaltigkeitsgedanke heute noch?
Ein Teil der Kundschaft ist sicher extrem auf dieses Thema fokussiert. Aber dieser Anteil ist nicht so gross, wie viele denken. Wenn man die Textilfirma von heute mit 1998 vergleicht, sieht man, dass man heute einfach zertifizierte Bio-Baumwolle und rezyklierte Garne einkaufen kann. Zertifizierungsstellen überprüfen Fabriken. Wir produzieren die Kleider in Indien vertikal integriert. Das heisst, jeder Produktionsschritt findet im Umkreis von etwa 20 Kilometern statt. Indien nähert sich dem europäischen Standard an. Ein Beispiel ist die Wasseraufbereitung bei den Färbereien in Tiruppur. Wind- und Solarenergie sind verbreitet und wichtig, um den Energiebedarf für die Fabriken zu decken.
Warum lohnt es sich für ein Unternehmen, auf langlebige Kleidung zu setzen?
Es ist ein Fakt, dass zehn Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen aus der Textilindustrie stammen. Für mich ist es nachhaltig, wenn ich die Kundschaft dazu bringe, weniger zu konsumieren. Das wirkt sich positiv auf den CO₂-Ausstoss aus. Ich hole mir die Kunden vom Fast-Fashion-Bereich. Auch wer langlebige T-Shirts kauft, wird es nach ein paar Jahren ersetzen oder eines in einer anderen Farbe zulegen. Aber er wird nicht 15 Shirts pro Jahr kaufen. Der Kunde will in erster Linie ein gutes und schönes Produkt, das möglichst nachhaltig produziert ist. Findet er nichts, ist er weg.
Wie haben sich die Einkaufspreise entwickelt?
Produkte aus Indien waren schon immer etwas teurer als jene aus Bangladesch oder China. Indien ist ein stabiles Land. Die Zollerleichterungen, die seit Anfang Jahr zwischen Indien und der Schweiz gelten, kommen uns etwas entgegen. Wenn die Rohstoffe wieder teurer werden, müssen wir die Verkaufspreise nicht sofort anheben.
Ist eine Produktion in Europa kein Thema?
Wir schauen es an. Es gibt verschiedene Wertschöpfungsketten, auch mit preislich interessanten Veredelungsbetrieben in der Schweiz. Vielleicht finden wir eine hybride Form mit einem grossen Anteil aus Indien und einer kleinen Kollektion aus der Schweiz oder einem anderen europäischen Land.
Seit zweieinhalb Jahren befinden sich Zentrallager und Hauptbüro in Frick. Wie viele Angestellte haben Sie?
Wir sind vier Festangestellte. Sechs Teilzeitmitarbeitende arbeiten im Stundenlohn. Mütter, die alle in der Region wohnen, schätzen die Flexibilität. Solche Jobs sind rar. Im Sommer beginnt der erste Lehrling in der Logistik. Ein anderer hat bei uns die KV-Lehre fertig gemacht. Ich will aber nicht ganz schnell viele Leute anstellen und dann laufen die Kosten aus dem Ruder. Wir investieren lieber in die Entwicklung.
Wie hoch war der Umsatz letztes Jahr?
Knapp 3 Millionen. Das waren etwa 400’000 Franken mehr als 2023. Für das laufende Jahr rechnen wir mit 3,5 bis 4 Millionen. Momentan wachsen wir stark, aber nicht in allen Bereichen. Mehr als 5 Millionen Franken Umsatz wird mit dem aktuellen Set-up nicht möglich sein. Wir hatten in den letzten Jahren auch kritische Momente und überlegten uns, die Firma wieder runterzufahren. In der Textilindustrie kann das sehr schnell gehen. Wachstum kann zum Problem werden.
Wenn Sie auf die 1981 gegründete Marke zurückblicken. Welche Haupterkenntnis nehmen Sie aus der Firmengeschichte mit?
Die Firma ist von 1981 bis 2001 stets gewachsen. 2005/2006 machte man grosse Sprünge, investierte stark in neue Sortimente, in den Outdoor-Bereich und in neue Läden. Innert kürzester Zeit stieg der Umsatz von 50 auf 100 Millionen. Dann gab es Krisen am Markt und man wartete zu lange mit Korrekturen. Es entstanden riesige Überbestände. Man holte neue Investoren. Chefs wurden ausgewechselt, und es gab Streit mit dem Gründer, der früher ein wichtiger Kompass war. Die DNA von Switcher ging verloren. 2010 holte sich der Gründer das operative Geschäft mit Unterstützung seiner indischen Produzenten zurück, die damit überfordert waren. Im Konkursjahr machte Switcher noch 40 Millionen Franken Umsatz. Man hätte die Firma noch retten können.

Worauf sind Sie persönlich besonders stolz?
Das ist ein grosses Wort. Stolz bin ich, dass es uns vor drei Jahren gelungen ist, unser externes Lager in der Westschweiz, das kostentechnisch total aus dem Ruder gelaufen ist, nach Frick zu holen. Wir standen kurz vor der Schliessung und konnten innert kürzester Zeit die Plattform hier aufbauen. Die Firma beginnt jetzt Gewinn zu schreiben. Da kann man kurz innehalten, stolz sein. Dann geht es aber sofort weiter.
Welche Person hat Sie am meisten gefördert?
Firmengründer Robin Cornelius. Mit ihm arbeitete ich zwölf Jahre lang eng zusammen. Er war kreativ und innovativ. 2001 hatte er Visionen, die jetzt Realität werden. Ihm war klar, dass es eine komplette Rückverfolgbarkeit vom Produkt braucht, und führte einen entsprechenden Code ein. Damit war er ein Pionier. Gegen alle internen Widerstände bauten wir 2002 den ersten Online-Shop auf. Nur Cornelius wollte das und lag damit richtig. Nachhaltigkeitsrichtlinien erarbeitete er 1998 zusammen mit Nichtregierungsorganisationen. Heute gelten solche Standards weltweit, und die Leute wissen gar nicht, woher diese kommen.
Wird es wieder Switcher-Läden geben?
Wenn wir in Frick in der Nähe unseres Lagers eine geeignete Fläche finden, werden wir sicher einen Fabrikladen eröffnen. Der hat sicher Potenzial. Switcher wird oft verlangt. Dezentrale Läden hingegen bergen ein grosses Risiko. Für einen Mono-Label-Laden ist unser Sortiment zu klein. Wir sind am Abklären, wo wir uns auf einer kleinen Fläche in bestehenden Läden einmieten könnten. Interessant wären für uns auch Grossverteiler. Im Coop waren wir Anfang 2000 und wurden von der Eigenmarke Naturaline verdrängt. Es ist ein Kampf um jeden Quadratmeter. Ich bin offen für Migros, Loeb, Aldi, Lidl oder andere. Aber nicht um jeden Preis.

Werden Sie ins Ausland expandieren?
Es ist schwierig, aus einem Schweizer Lager in die EU zu liefern. Viele Firmen möchten das, aber man weiss nicht, wie gross der Absatzmarkt ist. Die entsprechende Struktur aufzubauen, ist sehr kostenintensiv. Wir schauen jetzt, wie es mit unserem Online-Marktplatz Zalando läuft, und entscheiden dann, ob wir über Zalando eine Europa-Strategie inklusive Logistik fahren. Wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, sollten wir diese Herausforderung annehmen. Ich glaube, unsere Marke hat in der EU Potenzial.
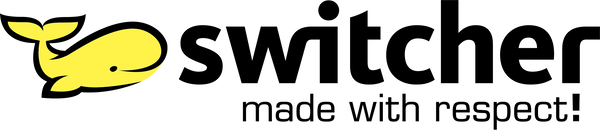

















































Hinterlasse einen Kommentar